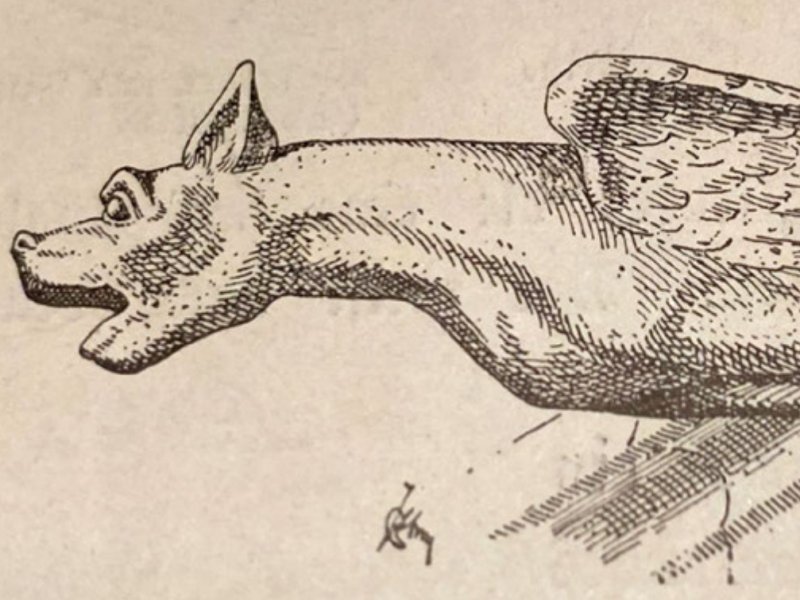Teil 29: Die Niederschlagsentwässerung in früherer Zeit
Sumpfige Areale prägten das spätmittelalterliche Dresden. Um sie passieren zu können, wurden Knüppeldämme oder Holzrutenwege angelegt, wie sie bei Ausgrabungen z.B. auf der Badergasse, dem Altmarkt und der Schlossstraße in Tiefen bis zu 2,5 Meter unter heutigem Gelände entdeckt wurden. Der Fund auf der Schlossstraße erfolgte im Übrigen im Zuge des Baus des Mischwasserkanals der Neuen Kanalisation im Jahre 1898. Gepflastert waren einige Straßen und Plätze bereits vor dem 15. Jahrhundert. Man verwendete dafür Steine (Wacken) aus dem Flussbett der Weißeritz. Der Archivar und Bibliothekar der Stadt Dresden, Dr. Otto Richter, schreibt 1891: „Ob sich dieses Pflaster aber schon über die ganze Straßenbreite erstreckt oder nur schmale Steinwege, wie auf den größeren Plätzen, gebildet hat, muss dahingestellt bleiben. Sicher ist es, dass die Stadtgemeinde sich noch im 16. Jahrhundert darauf beschränkte, in der Mitte der Straße ein Schleusengerinne abpflastern zu lassen, und dass es dann Sache der Hausbesitzer war, auf ihre Kosten jeder vor seiner Thür mit dem Pflaster nachzufallen.“ 1556 wurden den Bewohnern der Töpfergasse für die Straßenpflasterung immerhin von der Stadt Steine und Sand zugesagt. Vor den Häusern prominenter Persönlichkeiten ließ der Rat das Pflaster in Ausnahmefällen auf Stadtkosten verlegen. Die gepflasterten Straßen endeten bis hinein ins 17. Jahrhundert an den Stadttoren.
Straßenentwässerung
Die Straßenwässer im gotischen Dresden des 13./14. Jahrhunderts gelangten, soweit keine Gewässer wie der Burg- oder Stadtgraben, die Elbe, ein Weißeritzarm oder der Kaitzbach angrenzten, in feuchte Senken bzw. Gruben, wie sie z.B. bei den archäologischen Grabungen an der Zahnsgasse und zwischen Scheffelstraße und Webergasse nachgewiesen wurden. Die ältesten Dresdner Abflussrinnen wurden bei 1995 erfolgten Ausgrabungen auf dem Altmarkt und am Kanzleihaus entdeckt. Sie waren bereits Ende des 12. Jahrhunderts in oberflächig anstehende Lehmschichten gegraben worden. Nach 1553 wurde im gesamten Stadtgebiet eine Pflasternivellierung durchgeführt, die beispielsweise auf der Breiten Straße ein um ca. einen Meter angehobenes Niveau nach sich zog. Die Herstellung von Fußwegen gehörte allerdings noch nicht dazu. „Steinkegel, Querketten, Bänke und Quader“ dienten als Trittsteine und wurden in dem Bedürfnis, die Straßen trockenen Fußes passieren zu können, in privater Regie verlegt. Erst 1829 legte eine königliche Verordnung die Pflicht der Herstellung von regulären Trottoirs fest. Wie auch noch heute, blieb der Straßenzustand über die Jahrhunderte immer wieder Gegenstand von politischen Diskussionen sowie Erhaltungs- bzw. Ersatzneubaumaßnahmen.
Traufgassen und Traufrecht
Etwa bis zum Ende der Barockzeit verfügten die Dresdner Häuser nicht über Dachrinnen. Die Ratsakten des Jahres 1474 beschreiben, dass „sehr viele kleine Häuser giebelständig zur Straße ausgerichtet standen und durch schmale Durchgänge, die zur Ableitung des Regenwassers dienten, getrennt waren“. Diese Traufgassen (von tropfen bzw. tröpfeln), die in Dresden auch „flutrynen“ oder – sächsisch – „trofen“ genannt wurden, verfügten über Bodenrinnen mit Längsgefälle. In anderen Regionen hießen sie Schmutzgässchen, enge Reihe, Zwische, Reule, Winkel oder Ehgraben. Straßenseitig waren sie mit unten offenen Brettertüren verschlossen. Das „Traufrecht“ war von alters her Gegenstand von Bauvorschriften, deren Zweck es war, dass „kein Nachbar an des andern Traufe so nahe bauen darf, dass dadurch der Ablauf des Wassers gehindert werde, oder ein anderer Nachtheil dem Besitzer des Traufrechtes daraus erwachsen könnte.“ Dieser Rechtsanspruch auf einen freigelassenen Randstreifen um das Gebäude herum verhinderte zudem Grenzbebauungen. Das Traufrecht erstreckte sich vom Haus bis an das Kehlgerinne (Schnittgerinne) bzw. – bei Nichtvorhandensein eines solchen – anderthalb Ellen weit vom Haus weg. Traufgassen dienten vermutlich auch als oberirdische Rinnen für Abwässer aller Art, die auf diese Weise auf die Straßen bzw. in die gepflasterten Abflussrinnen derselben liefen. Traufwasser wurde auch durch Nachbargrundstücke oder in Tümpel und Senken der Höfe und Gärten geleitet und sorgte für nachbarlichen Zwist. Das Dresdner Stadtbuch belegt einige juristische Auseinandersetzungen über entsprechende Nutzungsrechte. Als Beispiel sei die Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Brewer und Stefan Slaynhuffen vom 5. Dezember 1481 angeführt. Gegenstand ist eine Abwasserrinne, „die zcwuschen irer beider hußer lyt, also das Jocoff Bruwer dieselbe rynne alleyne halden sal Stephan Slaynhuffner ane schaden“. In den auf den großen Stadtbrand von 1491 folgenden Jahrzehnten wurde die mittelalterliche, giebelständige Bebauung durch modernere Steinbauten ersetzt. Die Traufgassen wurden überbaut. Niederschlagswasser wurde nun durch Wasserspeier, wie sie z.B. auf den um 1750 entstandenen Canaletto-Gemälden zu sehen sind, von den Gebäuden weggeleitet. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann man, Fallleitungen zu installieren, die zumindest teilweise über dem Trottoir endeten. Mit der Bauordnung von 1859 wurden die Hauseigentümer aufgefordert, in den Gehsteig „an der Ausmündung des Abfallrohres ein rundes zur Aufnahme des ausströmenden Wassers dienendes Becken“ mit einem sich daran anschließenden „Gerinne in zweckentsprechender Tiefe, Breite und resp. Länge einhauen zu lassen“ – die Geburtsstunde der Dachrinnensenktöpfe mit Anschluss an das flach gegründete Schleusensystem der Alten Kanalisation.
Autor: Frank Männig, Stadtentwässerung Dresden GmbH, wird fortgesetzt.